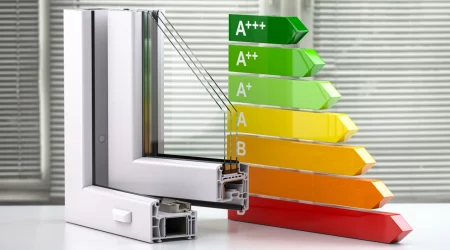Ein Passivhaus ist ein Gebäude, in dem zu allen Jahreszeiten eine angenehme Raumtemperatur herrscht – ohne Klimaanlage und ohne Heizung. Denn aufgrund einer nahezu perfekten Dämmung sinkt der Wärmeverlust auf ein Minimum. Passivhausfenster haben daran ihren Anteil.
Alles auf einen Blick:
- Ein Passivhausfenster muss den Passivhausstandards genügen. Dafür darf es einen maximalen U-Wert von 0,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin vorweisen.
- Zudem muss die Bilanz der Solarenergie zu jeder Jahreszeit positiv sein. Hierfür verantwortlich ist der Gesamtenergiedurchlassgrad, kurz g-Wert.
- Das Fenster besteht meist aus Kunststoffrahmen und einer Dreifachverglasung mit einer sogenannten warmen Kante im Rahmenverbund. Das verhindert Wärmebrücken.
- Die Low-E-Schicht sorgt dafür, dass ein Großteil der Sonnenstrahlen in den Raum gelangen und gleichzeitig die Raumwärme nicht entweicht.
- In den vergangenen Jahren bieten immer mehr Hersteller passivhaustaugliche Fenster an. Achten Sie beim Kauf auf der Zertifikat des Passivhaus Instituts.
- Der Preis ist vom genauen U-Wert abhängig. Diesen bestimmen verschiedenen Faktoren, wie das Rahmenmaterial samt Abstandshalter, die Verglasung oder Zusatzausstattungen wie Schall- oder Einbruchschutz. Für ein Basisfenster mit einer Fläche von einem Quadratmeter sollten Sie 300 Euro kalkulieren.
Definition und Anforderungen
Ein Passivhausfenster muss die Standards eines Passivhauses erfüllen. Dazu gehören Werte wie die Heizlast, der Heizwärmebedarf und die Luftdichtheit. Daher bestehen diese Fensterarten meist aus einer dreifachverglasten Fensterscheibe, einem Kunststoffrahmen und einer Low-E-Schicht.
Was ist ein Passivhausfenster?
Ein Passivhausfenster ist ein Fenster, das den hohen energetischen Effizienzanforderungen eines Passivhauses gerecht wird und über einen geringen Wärmeverlust verfügt. Weitere, gebräuchliche Begriffe sind Passivfenster und Warmfenster.
Diese Fensterbauart besitzt einen Wärmedurchgangskoeffizienten, den U-Wert, von unter 0,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Der U-Wert gibt die Wärmedurchlässigkeit des gesamten Fensters, also Rahmen und Scheibe, an. Zudem sind die Passivhausfenster mit einem hohen, wärmedämmenden Rahmen sowie einer Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung und nicht mit einem reinen Isolierglas ausgestattet.
Entgegen der weitläufigen Annahme können Passivhausfenster nicht nur in Passivhäusern eingebaut werden. Eine Montage in einem Altbau ist ebenso möglich, solange die Fassade ausreichend gedämmt ist. Ansonsten droht aufgrund der erhöhten Luftfeuchtigkeit im Raum Schimmelbildung.
Was ist ein Passivhaus?
Das Passivhaus ist ein Gebäude, das besonders energieeffizient und gedämmt ist. Es bezieht seine Wärme zum Heizen aus passiven Quellen – darunter eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die Wärme der Menschen und Sonnenstrahlen sowie eine gute Wärmedämmung der gesamten Gebäudehülle. Ein aktives Heizsystem durch einer Holz-, Öl- oder Gasheizung ist nicht notwendig.
Als Passivhaus definiert das bundesweit prüfende Passivhaus Institut Darmstadt ein Gebäude, das folgende Kriterien erfüllt:
- Heizwärmebedarf von maximale 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr
- Heizlast von maximal 10 Watt pro Quadratmeter
- Luftdichtheit der Gebäudehülle von n = 0,6 pro Stunde bei 50 Pascal
- Primärenergiebedarf im Jahr von maximal 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter
Daraus resultieren auch bestimmte Anforderungen für das Fenster, das Teil der Gebäudedämmung ist.
Welche Anforderungen müssen Fenster für Passivhäuser erfüllen?
Wie für das Passivhaus legt das zertifizierende Passivhaus Institut auch die Anforderungen für die Passivhausfenster fest. Grundsätzlich legt es dabei viel Wert auf die sogenannte Behaglichkeit, also den Wohnkomfort. Diese ist in der DIN EN ISO 7730 definiert. Die Behaglichkeit ist gegeben, wenn die mittlere Oberflächentemperatur der Innenoberfläche im Winter nicht mehr als drei Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegt. Daraus ergeben sich folgende Normen für die Verglasung und Fensterrahmen:
Wärmedurchgangskoeffizient:
Der U-Wert eines Fensters, auch Uw-Wert, darf bei Passivhausfenstern nicht mehr als 0,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin betragen. Zum Vergleich: Ein Standardfenster nach der neuesten Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) ist mit einem U-Wert von 1,3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin zugelassen.
Dabei umfasst der U-Wert das gesamte Fenster. Nach der Norm EN 10077 unterteilt sich der U-Wert in folgende Komponenten:
- Ug-Wert für die Verglasung
- Uf-Wert für den Fensterrahmen
- Dazu kommen noch der Wärmebrückenverlustkoeffizient am Glasrand und der Wärmebrückenverlustkoeffizient durch den Fenstereinbau in der Außenwand.
Solarer Energiegewinn:
Für ein Passivhaus ist nicht nur der U-Wert wichtig. Auch der Gesamtenergiedurchlassgrad eines Fensters, der g-Wert, ist ein Faktor. Er gibt Auskunft, wie viel Wärmenergie der Sonnenstrahlen durch die Scheibe in das Gebäudeinnere gelangt und an die Raumluft abgegeben wird. Ein g-Wert von 1 bedeutet einen Wärmegewinn von 100 Prozent. Bei Passivhausfenstern sollte er bestenfalls bei 0,5 liegen und 0,6 nicht übersteigen.
Bei Passivfenstern sollte der g-Wert immer positiv sein – auch im Winter. Denn nur so kann mit den Sonnenstrahlen mehr Energie aufgenommen werden, als während einer Heizperiode in der kalten Jahreszeit nach außen dringt.
Die Herausforderung bei Passivfenstern liegt in der Mischung aus gutem U-Wert zur Wärmedämmung der Fenster und gutem g-Wert zum solaren Wärmegewinn. Denn ein guter g-Wert geht eigentlich mit einem schlechteren U-Wert einher. Konkret: Ist der g-Wert hoch, bedeutet dies, dass prozentual viel Sonnenlicht durch die Scheibe kommt – gut für die Wärme, die von außen in den Raum soll. Umgekehrt wird aber auch ein hoher Prozentsatz der Raumwärme durch das Fenster nach außen gelangen, da der U-Wert automatisch hoch ist. Als optimale Mischung haben sich die Werte von 0,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin für den Wärmedurchgangskoeffizienten sowie von 0,5 für den Gesamtenergiedurchlassgrad erwiesen.
Aufbau und Eigenschaften
Um seinen Beitrag zu einem passivhaustauglichen Gebäude zu leisten, muss ein Fenster höchste Anforderungen erfüllen. So muss es in der Regel eine Dreifachverglasung und einen gedämmten Fensterrahmen mit einem speziellen Randverbund besitzen.
Wie ist ein Passivhausfenster aufgebaut?
Dreifachverglaste Wärmeisolierfenster sind für Passivhausfenster mittlerweile beinahe Standard. Denn bei einer Dreifachverglasung liegt der U-Wert verlässlich unter 0,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Auch die Oberflächentemperatur pendelt sich bei mindestens 17-18 Grad Celsius ein, wodurch Sie keinen oder nur einen geringfügigen Unterschied zur Raumtemperatur merken.. Ein zweifachverglastes Isolierfenster mit Argon wird den geforderten U-Wert nicht erreichen.
Die zwei Scheibenzwischenräume bei einer Dreifachverglasung sind mit Edelgasen, beispielsweise Argon oder Krypton, gefüllt und im Randverbund montiert. Zudem sind die Scheiben mit einer dünnen Metallschicht beschichtet, um aus dem Raum ausströmende Wärme zu blocken. Diese Low-E-Schicht befindet sich jeweils an der zur Mittelscheibe gewandten Innenseite der beiden äußeren Scheiben. Die Schicht lässt den Großteil der Sonnenstrahlen in den Raum und verhindert durch Reflexion gleichzeitig, dass die Raumwärme entweicht.
Um die Wärmeleitfähigkeit weiter zu reduzieren, ist eine sogenannte warme Kante im Randverbund angebracht. Dieser ist mit Abstandshaltern und Dichtungen ausgestattet, hält die Scheibenkonstruktion zusammen und bewahrt das Edelgas in den Zwischenräumen. Um Wärmebrücken in den Scheibenzwischenräumen zu vermeiden, sind die Abstandshalter und Dichtungen mit einem Material wie Polyisobutylen ausgestattet.
Umlaufende Dichtungen schließen die Lücken zwischen Fensterscheibe und Fensterrahmen.
Der Fensterrahmen wird möglichst flach gebaut, um den Licht- und damit den Energiegewinn über die Scheibe zu maximieren. In der Regel wird ein Passivfenster aus Kunststoff oder einer Kunststoff-Aluminium-Verbindung bestehen, seltener aus einer Holz-Aluminium-Kombination. Denn Holz hat die schlechteste Wärmedämmung dieser Materialien.
Passivhausfenster mit Kunststoffrahmen besitzen zur besseren Wärmedämmung ein Mehrkammern-Profil, meist ein 6-Kammer-Profil-System. Diese sind teilweise mit Dämmschaum gefüllt, wodurch die Energieeffizienz nochmal steigt.
Welche Eigenschaften machen passivhaustaugliche Fenster aus?
Durch den geringen U-Wert für eine gute Wärmeisolierung und einem entsprechenden Energiedurchlassgrad kann ein Passivhausfenster die Solarenergie nutzen und gleichzeitig eine effiziente Wärmedämmung sicherstellen.
Vorteile:
- Dämmung: Durch die hervorragenden Eigenschaften der Fenster zur Wärmedämmung entstehen kaum bis keine Heizkosten. Im Konzept eines Passivhauses ist ohnehin eine Heizung nur im äußersten Notfall vorgesehen.
- Solarwärme: Durch die Konzeption und Bauart erwärmt die Sonne mit ihren Strahlen die Räume – und das ohne Kosten zu verursachen.
- Thermische Behaglichkeit: Die Temperatur der Fensteroberfläche sinkt nicht so stark ab wie bei anderen Fenstern. So besteht die thermische Behaglichkeit auch ohne große Heizkosten. Denn die im Winter auftretende Kältestrahlung am Fenster und die sogenannten Kaltluftseen oberhalb des Bodens werden durch die Bauweise verhindert.
- Energieersparnis: Passivhausfenster können Sie auch in Häuser einbauen lassen, die noch nicht allen Standards des Passivhauses entsprechen. So lassen sich bis zu 8 Liter Heizöl pro Quadratmeter Fensterfläche im Jahr einsparen.
Nachteile:
- Anschaffungskosten: Der Preis für solche Fenster liegt deutlich über dem herkömmlicher Varianten. Durch die aufwendige Konstruktion, hier sind der flach verbaute Rahmen und die dreifache Verglasung zu nennen, sind die Kosten relativ hoch. Allerdings amortisieren sich die Anschaffungskosten mit der Zeit durch den deutlich geringeren Heizverbrauch in einem Passivhaus. Auch in einem normalen Neubau sinken die Heizkosten.
- Einbau: Damit die Passivhausfenster ihre komplette Funktionalität entfalten, müssen sie ordnungsgemäß eingebaut werden. Beispielsweise gilt es für die Luftdichtheit besondere Dichtungsbänder richtig zu platzieren, um Wärmebrücken zu verhindern. Die Montage ist daher relativ anspruchsvoll und nur von Experten durchzuführen. So haben Sie allerdings auch nach dem Einbau die Garantie.
Hersteller und Kosten
Die Zahl der Hersteller ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. So haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Fensterrahmenmaterialien. Der Preis ist neben dem Rahmen auch noch von den tatsächlichen Werten abhängig. Je besser die Qualität, desto teurer, aber desto mehr Energie lässt sich im Laufe der Zeit einsparen.
Welche Hersteller gibt es?
Die folgende Auswahl von Herstellern bietet vom Passivhaus Institut zertifizierte Fenster an:
Kunststoff:
- ACO Severin Ahlmann
- Aluplast
- Neufer
- Oknoplast
- Windor
Aluminium:
- Alcoa
- Aluprof
- Askonsult Adverso
- Batimet
- Neufer
Holz:
- Aluron
- Askonsult Adverso
- Batimet
- Bewiso
- Enersign
Was kosten Passivhausfenster?
Die Kosten hängen von etlichen Faktoren ab. Einen Einheitspreis zu nennen, ist daher nicht möglich. Beispielsweise ergeben sich durch das Rahmenmaterial deutliche Preisunterschiede. Kunststoff ist billiger als ein Kunststoff-Aluminium-Rahmen, der wiederum günstiger als ein Holz-, beziehungsweise Holz-Aluminium-Rahmen ist. Auch die Verglasungsart spielt eine Rolle, wenngleich Sie meist eine Dreifachverglasung wählen werden.
Durch Qualität steigt natürlich auch der Preis. So können Sie mit einem Abstandshalter „Warme Kante Premium“ den Passivhausstandard um einige Prozentpunkte unterschreiten, was sich wiederum positiv auf den Energieverbrauch auswirkt.
Auch Zusatzausstattungen, wie Schallschutz und Einbruchschutz spielen bei der Berechnung des Preises eine Rolle. Dazu kommt noch der Einbau, der aufgrund der Komplexität in jedem Fall von Experten durchgeführt werden sollte.
Ein einfaches Passivhausfenster mit einem Quadratmeter Fläche kostet mindestens 300 Euro. Die Montage ist eingerechnet, aber keine Kipp-Varianten. Eine zweiflügelige Dreh-Kipp-Variante liegt bei rund 400 Euro. Wenn Sie ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit Passivfenstern ausstatten möchten, sollten Sie mit Kosten zwischen 5.000 und 8.000 Euro rechnen.
Gibt es eine Förderung?
Für die Anschaffung neuer, vom Passivhaus Institut geprüfter Fenster können Sie Zuschüsse und Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragen. Eine Förderung ist in der Regel problemlos möglich, unterbieten diese Fenster doch deutlich die KfW-Vorgaben. Konkret handelt es sich um das KfW-Förderprogramm 430, das 10 Prozent der Investitionskosten bezuschusst und das Kreditprogramm 151/152. Darin enthalten ist ein maximaler Kredit von 100.000 Euro, der bei einer kompletten Sanierung greift. Immerhin 50.000 Euro gibt es für Einzelmaßnahmen. Abhängig von der Zahl des KfW-Effizienzhauses gibt es zusätzlich einen Tilgungszuschuss von maximal 27.500 Euro pro Wohneinheit.
Der Antrag ist vor Beginn der Baumaßnahmen einzureichen. Erkundigen Sie sich zudem nach regionalen Förderungen. Der Energieberater oder Fachbetrieb kann Ihnen dabei weiterhelfen.
Fazit
Um als Passivhausfenster zu gelten, muss ein Fenster in Ihrem Haus gewissen Anforderungen genügen. Es muss einen sehr geringen Wärmeverlust und einen hohen Solarwärmegewinn aufweisen. Gemessen werden diese vom Passivhaus Institut festgelegten Faktoren mit dem U-Wert für den Wärmedurchgangskoeffizienten und dem g-Wert für den Gesamtenergiedurchlassgrad. Ersterer darf 0,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin nicht übersteigen, letzterer sollte bei 0,5 liegen.
Meist sind Passivhausfenster mit einem Kunststoffrahmen oder Kunststoff-Aluminiumrahmen, einer dreifachen Verglasung und einer sogenannten warmen Kante im Rahmenverbund ausgestattet. Die Low-E-Schicht sorgt dafür, dass ein Großteil der Sonnenstrahlen in den Raum gelangen und gleichzeitig die Raumwärme nicht entweicht.
Der Preis für solche Fenster ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Ist ein Rahmen aus Kunststoff, Holz, Aluminium oder einer Kombination? Auch bei den Abstandhaltern, die Wärmebrücken vermeiden, ist die Qualität unterschiedlich. Genauso verhält es sich mit den Zusatzaustattungen. Für ein Basisfenster mit einer Fläche von einem Quadratmeter samt Einbau sollten Sie in jedem Fall 300 Euro berechnen. Allerdings rechnen sich die hohen Anschaffungskosten durch den wesentlich geringeren Verbrauch an Energie relativ schnell.