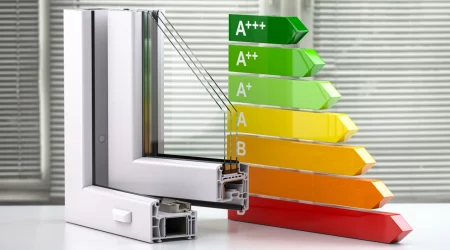Durch den Einbau neuer Fenster wollen viele Menschen die Energiekosten senken. Doch sollten Sie genau abwägen, für welche Zwecke Sie das Fenster sanieren wollen. Denn nicht immer ist ein niedriger U-Wert von Vorteil. Wir erklären Ihnen, welche Werte Sie beachten müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
Alles auf einen Blick:
- Der U-Wert beziffert den Wärmedurchgangskoeffizienten bei Fenstern.
- Der Ug-Wert gibt die Wärmeleitfähigkeit des Fensters wieder, der Uf-Wert die des Fensterrahmens. Zusammen bilden sie den Uw-Wert, der unter 1,3 W/qmK liegen sollte.
- Der G-Wert zeigt den Energiedurchlassgrad von außen nach innen an und sollte 0,6 W/qmK nicht übersteigen.
- Für den Einbau neuer Fenster sollten Sie den Uw-Wert und G-Wert beachten. Dabei gilt: Je niedriger, desto weniger Energie geht verloren. Dies muss allerdings nicht immer ein Vorteil sein.
U-Wert: Begriffserklärung und Berechnung
Der U-Wert beschreibt den Wärmestrom, der von einem Raum über das Fensters nach außen fließt. Er teilt sich auf in den Ug-und den Uf-Wert und wird in Watt pro Quadratmeter Fensterfläche und Kelvin angegeben. Die Energieeinsparverordnung setzt die Werte fest.
Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert, früher k-Wert, gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters an. Er definiert die Energie, die vom Raum durch das Fenster in einer bestimmten Zeit nach außen verloren geht. Generell gilt: Je niedriger er ist, desto effizienter ist die Wärmedämmung.
Der U-Wert untergliedert sich in den Ug-Wert und den Uf-Wert. Ersterer bezeichnet die Wärmeleitfähigkeit der Scheibe. Ebenso wichtig ist der Uf-Wert. Er gibt die Wärmeleitfähigkeit des Fensterrahmens an. Zusammen werden beide bauphysikalisch als Uw-Wert bezeichnet.
Wie wird der U-Wert berechnet?
Der U-Wert ermittelt den Wärmedurchfluss auf einer bestimmten Fläche in einer bestimmten Zeit bei fest definierten äußeren Bedingungen. Konkret heißt das beim Wärmedurchgangskoeffizienten: Wie viel Wärme fließt bei einem Kelvin Temperaturunterschied in einer Stunde zwischen innen und außen durch einen Quadratmeter Fensterfläche. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/qmK) angegeben.
Dabei gilt: Je geringer der Wärmedurchgangskoeffizient ist, desto weniger Luft entgleitet über die Fenster. Um die Leistung des Wärmestroms pro Quadratmeter Fensterfläche zu erhalten, multiplizieren Sie einfach den Uw-Wert Ihres Fensters mit der Temperaturdifferenz zwischen außen und innen.
Wie hoch sollte der U-Wert sein?
Die verbesserte Technik bei modernen Fenstern führte in den vergangenen Jahren zu restriktiveren Anforderungen. Laut Energieeinsparverordnung von 2014 (EnEV 2014) dürfen neu eingebaute Fenster den U-Wert von 1,3 W/qmK nicht übersteigen. Diese Zahl unterbieten Sie durch Fenster mit zweifachen und dreifachen Verglasungen. Einfachverglaste Fenster, die beim Einbau heute nicht mehr üblich sind, liegen bei mindestens 3,0 W/qmK und übersteigen den EnEV-Wert deutlich. Seit 2009 richten sich die EnEV-Werte nach dem Referenzgebäudeverfahren, das den aktuellen Stand der Technik widerspiegelt.
Hersteller werben auf Ihren Verpackungen meist mit einem niedrigen Ug-Wert. Um eine perfekte Dämmung Ihres Fensters zu erhalten, ist es wichtig, dass nicht nur das Glas, sondern auch der Rahmen einen entsprechenden Wert aufweisen. Daher sollten Sie stets den Uw-Wert beachten. Dieser ergibt aus folgender Rechnung: Summe von Ug- und Uf-Wert, geteilt durch zwei. Meist ist der Austausch des Glases und Rahmens bei einem neuen Fenstereinbau sinnvoller, um eine perfekte Wärmedämmung zu erzeugen.
Ein Nachteil von Bauteile mit niedrigem Wärmedurchgangskoeffizienten sind die höhere Anschaffungskosten.
U-Wert bei Fensterarten
Zur Wärmedämmung bei den verschiedenen Bauteilen wird der U-Wert herangezogen. Die Dreifachverglasung bietet dabei einen besseren Wärmeschutz als andere Verglasungen.
Wie hoch ist der U-Wert bei einer Dreifachverglasung?
Bei einer dreifachen Verglasung fällt der U-Wert geringer aus als bei einem Fenster mit zweifacher Verglasung. Dadurch entstehen höhere Energieeinsparungsmöglichkeiten. In der Regel weisen Fenster mit zweifacher Verglasung circa 1,1 W/qmK auf. Mit Edelgas gefüllte Dreifachverglasungen können den Wärmedurchgangskoeffizienten auf einen U-Wert von 0,5 W/qmK senken.
Daher sind Dreifachverglasungen besonders für Niedrigenergie– oder Passivhäusern geeignet. Allerdings sind diese Verglasungen teurer als andere Verglasungen. Der genaue Preis hängt von den einzelnen Bauteilen wie dem Rahmen und der Scheibe ab. Meist können Sie aber mit 15 Prozent Mehrausgaben rechnen als bei Zweifachverglasungen.
Welcher ist der U-Wert bei Holzfenstern?
Die aktuell gültige Energieeinsparverordnung (EnEV) gibt einen Uw-Richtwert von 1,3 W/qmK vor. Meist liegt der Durchschnittswert bei Holzfenstern bei 1,0 W/qmK. Abhängig ist diese Zahl neben dem Material und Hersteller auch von der Größe des Fensters.
Um den U-Wert bei Holzfenstern zu berechnen, gibt es zwei Normen. Die DIN EN ISO 10077 und die DIN EN 12422. Ersterer erfasst den Uf-Wert nur für das Gesamtbauteil und ist daher nicht so präzise wie die DIN EN 12422, die den Fensterrahmen seitlich und unten misst.
G-Wert: Begriffserklärung und Berechnung
Der G-Wert definiert die von außen nach innen fließende Energie durch das Fenster. Er wird bei Fenstern in Watt pro Quadratmeter Fensterfläche und Kelvin angegeben. Eine geringere Zahl bietet Vor- und Nachteile.
Was ist der G-Wert bei Fenstern?
Der G-Wert legt den Gesamtenergiedurchlassgrad fest. Er beziffert die durchdringende Energie von außen nach innen. Damit sind sowohl die direkt durchgelassene Sonnenstrahlung sowie die sekundäre Wärmeabgabe des Glases und Rahmens gemeint.
Er ist von Bedeutung, wenn es um die Wärme- und Sonnenschutz geht, bietet er doch einen Schutz vor Überhitzung durch zu starke Sonneneinstrahlung. Denn ein hoher Gesamtenergiedurchlassgrad sorgt dafür, dass die Sonnenstrahlen ungehindert in den Raum gelangen.
Wie wird der G-Wert berechnet?
Der G-Wert wird ebenfalls in W/qmK angegeben. Eine niedrige Zahl sorgt dafür, dass die Sonneneinstrahlung und Wärme in einem geringen Maße von außen in den Raum transportiert wird.
Für eine Erwärmung des Raums im Winter durch Sonneneinstrahlung bedarf es eines hohen G-Werts. Im Sommer hingegen, wenn Sie Ihr Zuhause kühl halten möchten, ist ein niedriger Wert nötig. Fensterscheiben mit einem geringen Gesamtenergiedurchlassgrad lassen allerdings auch weniger Tageslicht durch, wodurch Sie wieder mehr Licht in Ihrem Zuhause benötigen, was die Energiekosten nach oben treibt. Hier bietet sich dann wiederum ein Konzept zur energiesparenden Beleuchtung in Verbindung mit geringem G-Wert an.
Wie hoch ist der G-Wert für Fenster?
Laut EnEV 2014 darf der Gesamtenergiedurchlassgrad bei neu eingebauten Fenstern 0,6 W/qmK nicht überschreiten. Bei einer Dreifachverglasung liegt der Wert bei durchschnittlich 0,55 W/qmK, bei Zweifachverglasungen bei 0,65 W/qmK.
Ob ein niedriger Wert hilfreich oder hinderlich beim Energiehaushalt Ihres Zuhauses ist, hängt von Ihren persönlichen Anforderungen ab. Eine Sonnenschutzverglasung von 0,3 – 0,5 W/qmK heizt Ihren Raum im Sommer nicht so stark auf. Allerdings können Sie im Winter die Sonnenenergie auch nur zu einem geringen Teil zur Erwärmung Ihres Innenraums nutzen.
Fazit
Vor dem Einbau Ihres neuen Fensters sollten Sie auf den Uw-Wert und den G-Wert achten. Ersterer definiert den Wärmedurchgang von innen nach außen am Fensterglas und Fensterrahmen, letzterer die Wärmeeinstrahlung von außen nach innen. Geringe Werte zeugen von einer geringen Durchlässigkeit bei den Bauteilen. Was beim Uw-Wert im Sinne des Energiesparens sinnvoll ist, kann sich beim G-Wert negativ auswirken. Da Sie allerdings nicht halbjährlich Ihre Fenster austauschen können, empfiehlt sich eine fachmännische Beratung, welche Fenster für Ihre Anforderungen sinnvoll sind.